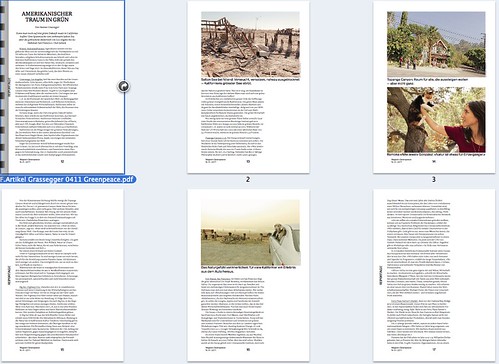Im Gespräch mit Simon Zadek
Ob bei der chinesischen Regierung, am World Economic Forum oder bei Konzernen wie Shell - Simon Zadek ist der Aktivist mit der Eintrittskarte. Seine Mission ist die Nachhaltigkeit. Das soziale und das ökologische in die Welt der Wirtschaft einzubringen. Und zwar ganz oben.
Begonnen hat Zadek ganz unten. 1993, als sich auf der ersten Rio-Konferenz die Diplomaten trafen, entwarf der frischpromovierte alternative Ökonom in einem schäbigen Gemeinschaftsbüro im Londoner East-End Sozialstandards. Die ersten Regeln, um Unternehmen in privater Initiative in die Nachhaltigkeit zu führen.
Es war die richtige Zeit. Schon bald rannten ihm Unternehmen auf der Flucht vor Ihren Kritikern die Tür ein. Shell, Néstlé, Nike, BP - Zadek arbeitete mit allen roten Tüchern der Umweltschutzbewegung. Heute erklärt er der chinesischen Regierung Green Growth, arbeitet mit chinesischen Behörden und Unternehmen an der Erstellung von Regeln zum sozialeren und ökologischeren Wirtschaften.
HG: Lassen Sie uns mit dem ersten grossen Gipfel zur Nachhaltigkeit beginnen. Der war noch recht politisch. Was hatte die erste Rio-Konferenz denn so mit Wirtschaft zu tun?
SZ: Die erste Rio Konferenz hatte noch gar keine Vorstellung von Business. Das Wort Green Growth gab es noch nicht. Aber: hier begann die Wirtschaft sich des Themas Nachhaltigkeit anzunehmen.
HG: Währenddessen sassen sie in einem kleinen Hinterhofbüro in London und wollten Unternehmensberater werden?
Was wir damals bei der New Economic Foundation (NEF) ausprobierten, war zum Nachhaltigkeits-Auditor für Unternehmen zu werden. Ökosoziale Prüfung war ein neuer Ansatz. Die Ersten, die zu uns kamen, waren Ben & Jerrys, Bodyshop – ikonische ethische Unternehmen der 1990er. Zusammen versuchten wir, herauszufinden wie man mit Standards Transparenz in Unternehmen erhöht, soziale Effekte misst...
HG: Plötzlich, 1995, gründeten Sie den weltweit ersten runden Tisch von Regierung, Unternehmen und Zivilgesellschaft zur „Moralisierung“ des Wirtschaftens, die „Ethical Trading Initiative“. Wie kam es zu diesem rasanten Aufstieg ihrer alternativen Ideen?
SZ: Es war als die Globalisierung anfing zu reifen. Mitte der 1990er hatten Aktivisten gelernt, wie man unter smartem Einsatz der Medien Kritik an Brands wie Nike üben konnten. Gleichzeitig war England Sitz vieler solcher Unternehmen – und ihrer Gegner, der NGOs. Das Land war traumatisiert durch den Schaden den Thatcher dem Gesellschaftsvertrag zugefügt hatte. Das kleine England wurde zum Labor. Weil das NEF und ich bereits mit kleinen Brands gearbeitet hatten um Sozialstandards und Messmethoden auszuprobieren, kontaktierten uns grössere Unternehmen, die damals vor der Herausforderung standen ihren Ruf zu wahren.
HG: Welches waren die ersten grossen Kunden?
SZ: BP kam wegen Casanares, Shell wegen Brent Spar. Und British Telecom, damals DAS „böse Unternehmen“ in England. 1998 wurden sie die drei ersten Unternehmen, die die Menschenrechte in ihre Richtlinien aufnahmen.
HG: Wie kam der Kontakt zustande?
SZ: Wir sassen einfach da – und die Firmenvertreter kamen zu uns. Es war der Beginn eines Zeitalters, in welchem die Markennamen von Firmen mehr Wert wurden als ihre restlichen Besitztümer. Dieser Wert war bedroht. Das war neu und die Unternehmen hatten keine Ahnung was für Instrumente ihnen helfen konnten.
HG: Mit was für Menschen hatten Sie da zu tun?
SZ: Beispielsweise John Brown, damals CEO von BP. Als bei dem in Casanares die Dinge schief liefen, konnte er es erst gar nicht glauben. Es war unfassbar: seine Firma Komplizin in Menschenrechtsverletzungen! Als er sah, dass es wirklich stimmte, dass sein Unternehmen in Morde verwickelt war, öffnete er sich total. Nicht einfach um sein Unternehmen zu schützen. Er war aufgerüttelt. Moralisch. Genauso Shell Vorstand Mark Moody-Stuart, oder Phil Knight von Nike. Das waren sehr moralische Menschen. Die sahen mehr als nur ihr Unternehmen.
HG: Phil Knight ein moralischer Mensch?
SZ: Nike war ein ganz junges Unternehmen. 25 Jahre alt. Keine einzige Führungskraft hatte je einen Gewerkschaftsvertreter ausserhalb der USA getroffen. Die hatten gar keine Ahnung. Dieses Unternehmen hat weltweite Wertschöpfungsketten quasi erfunden!
HG: Sie behaupten Nike sei naiv gewesen?
SZ: Für einen jungen Aktivisten würde das lächerlich klingen. Aber es stimmt. Nike wollte erfolgreich sein. Aber die wollten nicht Menschen schädigen. Die Konstellation aus Unternehmen und Kritikern erinnert daran, wie heute chinesische Unternehmen wahrgenommen werden im Westen. Die wollen auch Gewinne machen in anderen Ländern von denen sie wenig Ahnung haben. Genau wie mit Nike: Jedesmal wenn etwas bekannt wird, was die Chinesen falsch gemacht haben, folgt der Aufschrei: Uuh! Die sind böse, die kümmern sich nicht darum wie es Menschen geht. Wenn die Chinesen in Afrika produzieren, Rohstoffe abbauen, dann stehen sie auch, wie Nike damals, vor ganz neuen, unbekannten Situationen.
HG: Und dann kommt Herr Zadek und erzählt den chinesischen Unternehmern von Menschenrechten! Sie beraten mittlerweile auch in China.
SZ: Die meiste Zeit in China rede ich mit der Regierung. Das ist in China extrem wichtig dafür wie sich Unternehmen verhalten. Ich habe ein Jahr lang mit einer Unterabteilung des Wirtschaftsministeriums, dem „Chinese Council for International Cooperation in Environmental Development“ geprüft, wie die Regierung Richtlinien erlassen kann um das soziale und ökologische Verhalten chinesischer Unternehmen im Ausland zu verbessern.
HG: Warum kümmern sich die Chinesen überhaupt um Nachhaltigkeit?
SZ: Ich seh Gründe auf drei Ebenen. Jede Firma, die gross werden will, muss an ihren Markenwert denken. Zweitens: In den nächsten fünf bis acht Jahren will China als Staat im Ausland eine Billion Dollar in Unternehmen investieren. Das hat Premier Wen 2011 in Davos verkündet. Um komplikationsfrei Firmen kaufen zu können, braucht China eine funktionierende China Inc. Marke.
HG: Und die dritte Ebene?
SZ: Geopolitisch. Jede Supermacht muss Macht auf drei Ebenen entfalten. Militärisch, wirtschaftlich und moralisch. Die Amerikaner hatten Soft Power mit individueller Freiheit und so. Die Chinesen werden die erste Supermacht werden die Nachhaltigkeit ins Zentrum stellt. Nicht weil sie Priester sind. Sie brauchen eine moralische Story um zur Supermacht zu werden.
HG: Hat China keine wirkliche Moral?
SZ: Es ist ein komplizierter Mix verschiedener Gründe, Ziele, Personen. Zurück zu den Erfahrungen mit Phil Knight: Es ist nicht hilfreich zu fragen, ob man aus Moral oder aus Pragmatismus handelt. Hilfreich ist zu fragen: Hat es einen Effekt? Verändert es die Kultur der Unternehmung?
HG: Ein Beispiel?
SZ: Seit John Brown weg ist, wurde klar, dass er es nicht geschafft hat, seine sozialen und ökologischen Konzepte bei BP zu verankern. Während Mark Moody-Stuart sie bei Shell bis in die DNA des Unternehmens hineintrug.
HG: Néstlé hat während Ihrer Beratungszeit Aktivisten bespitzeln lassen. Schmerzt das?
SZ: Nein. Ist es gut? Nein. Überrascht es mich? Nein. Die interessantesten Unternehmen sind die, die zugleich in der Vergangenheit und der Zukunft leben. Sie sind komplett schizophren. Die Unternehmen mit den interessantesten Projekten, haben einen Fuss im Dreck und den Kopf in den Wolken. Das kann man nur mit Führungskraft managen. Als grosses Unternehmen gibt es Sachen, die will und sollte man lieber nicht tun. Aber man tut sie, weil man Geschäfte macht. Gleichzeitig kann man versuchen, etwas zu verändern.
HG: Wie wissen Sie eigentlich ob Sie überhaupt etwas erreicht haben?
SZ: Es ist völlig unklar in dieser Welt, welche Handlungen was auslösen.
HG: Sie als Spezialist für Standards müssen doch wissen, wie man Wirkung misst!
SZ: In den letzten 15 Jahren sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit erstens Mainstream geworden. Zweitens ist vieles was wir propagierten, Bestandteil von Geschäftspraktiken, Gesetzgebung oder der öffentlichen Diskussion geworden: Sozialstandards in Unternehmen, Moral bei medizinischen Versuchen, Privatsphäre im Netz, hunderte solche Themen...
HG:...in der westlichen Welt...
SZ: Noch vor drei Jahren wäre es unmöglich gewesen, in Beijing eine Konferenz zum Thema Natur-Zerstörung in Afrika zu veranstalten. Letztes Jahr haben wir genau das getan. Fortschritt zu belegen ist einfach. Das wahre Problem ist: Der Fortschritt ist so klein im Verhältnis zum Problem, dass er selber zum Teil des Problems wird.
HG: Das verstehe ich nicht.
SZ: Wenn die kleinen positiven Veränderungen von Unternehmen oder Regierungen nur als Beleg genutzt werden, dass man ja „etwas tut“, dann wird der kleine Fortschritt zum Teil des Problem.
HG: Sie meinen Greenwashing.
SZ: Das Vereinnahmungs-Problem von jedem, der Veränderung will und mit „der Macht“ arbeitet lautet: Wie kann ich verhindern, dass die Sachen, die ich tue, Teil des Problems werden? Ob Sklavenbefreiung oder Frauenrechte: Es war stets diese Frage. Wie kommen wir zum echten Wandel. Und führen kleine Schritte dorthin – oder ins grosse Problem.
HG: Sie meinten kürzlich, dass uns grosse Problem bevorstehen.
SZ: Es ist eine sehr dunkle Zeit. Alles steht auf der Kippe. Die Spannungen wegen sozialer Ungleichheit wachsen, auch in Europa. Vor 60 Jahren wären wir in dieser Situation in den Krieg gezogen. Andererseits ist nun alles offen. Darum sind das Occupy Movement und der Arabische Frühling so wichtig. Heute sieht die Mittelklasse, dass die Zukunft schlecht aussieht. Das ist gut. Das gibt uns politischen Raum. Jetzt ist Wandel möglich. Es gab noch nie so einen grossartigen Moment in meinem Berufsleben.
Par Hannes Grassegger
Peut-on encore espérer un avenir écologique «made in California»? Une invitation au voyage, entre le lac agonisant de Salton Sea, l’imagerie brisée de Los Angeles et San Francisco la florissante.
Niland, Sud-Est de la Californie. La chaleur et l’odeur
d’ammoniaque provenant des cadavres de poissons sont di!cilement supportables. Je suis dans le Sud-Est de la Californie, au pied de «Salvation Mountain», un amas de déchets recouvert d’argile et peinturluré de slogans et de références bibliques. Juste à côté, le plus grand lac de Californie agonise en silence. Le «Salton Sea» est pollué, salinisé, abandonné. Une ambiance d’apocalypse. En repartant à bord de ma Dodge, je me demande si la Californie, cette région où se mêlent Disneyland et les visions apocalyptiques du «Jour d’après», est vraiment le pays promis qui montrera la voie à l’Occident.
En route, Los Angeles. Depuis près de deux heures, je suis bloqué sur l’autoroute du centre-ville. Dix voies en parallèle, tout est engorgé, même la voie de dépassement réservée au covoiturage écologique. Aller d’Echo Park à Topanga Canyon me prendrait cinq heures en transports publics. Les réseaux de trains régionaux et de bus sont insu!sants, et la dégradation des "nances de la ville contribue à les réduire encore davantage. Los Angeles est le fer de lance du monde occidental. Entre Disneyland et Hollywood s’étend une agglomération de 12,8 millions d’habitants, un des principaux pôles économiques de la planète.
La Californie est la dixième économie au monde et la première des Etats-Unis. On a longtemps pensé que l’avenir écologique des Etats-Unis ne pourrait venir que de la Californie et de ses entreprises. La ruée vers l’or, Berkeley et ses manifestations, Davis la ville écologique modèle, mais aussi HP, Google ou l’iPad sont immédiatement associés au nom de cette région. Et 34 des 100 principales entreprises de technologie propre sont basées en Californie.
La Californie est aussi le berceau de quelques-uns des principaux bouleversements que le monde occidental a traversés ces dernières décennies: la Haight Street de San Francisco est le symbole de la génération hippie; Apple a changé notre quotidien et l’Etat a une législation environnementale parmi les plus sévères au monde.
En Californie, même l’ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger est devenu un écologiste convaincu. En juillet 2006, il surprend tout le monde en proposant d’introduire un o!ce de protection du climat et en élaborant un plan d’action contre le réchau#ement de la planète. Le 27 septembre 2006, il signe la loi environnementale la plus stricte que la nation n’ait jamais vue.
Mais au terme de son mandat, les "nances publiques sont à sec et les crises se succèdent. Peut-on encore espérer une révolution verte venant de Californie?
Au début de l’automne 2011, des pans entiers du secteur de l’énergie verte s’e#ondrent. La bulle verte éclate avec la faillite de Solyndra, un fabricant de cellules solaires qui engloutit 500 millions de dollars de subventions dans sa chute. L’a#aire devient un problème pour la campagne électorale de Barack Obama. L’économie verte venait à peine de s’a!rmer et voilà qu’elle implose.
La plupart des grands projets ne se sont pas réalisés. Selon une étude de la Brookings Institution, la Californie ne comptait que 320 000 emplois dans le secteur de l’écologie à la mi-2011, dont un peu moins de 90 000 pour la zone de Los Angeles. Et alors que l’économie américaine a progressé de 4,2% par année depuis 2003, la croissance du secteur vert s’est limitée à 3,4% en moyenne.
Topanga Canyon, Los Angeles.
Le smog m’obstrue les poumons. Ramona Gonzalez m’attend depuis une heure. Cette musicienne de 27 ans incarne la génération bohémienne des quartiers d’Echo Park et de Silver Lake. Son nom de scène est Nite Jewel, ses productions entreraient dans la rubrique «Urban» sous iTunes Radio.
Après des études de philosophie, la "lle de L.A. a récemment quitté la ville pour se «mettre au vert». Partant de la route côtière en direction de Malibu, on bifurque vers Topanga Canyon et s’enfonce dans une vallée de plus en plus verte.
Jouxtant Los Angeles, la région offre un refuge à ceux qui veulent échapper à la ville sans se couper de tout. On y trouve aussi bien des artistes que des hommes d’affaires.
Neil Young, la rockstar qui voulait changer le monde avec son véhicule électrique Lincvolt, est un ancien habitant.
Au restaurant Froggy’s, les magazines gratuits portent des titres comme Réveil à la nature. Ramona a!rme s’y sentir plus heureuse, plus légère, moins soucieuse qu’en ville. Le lieu est propice aux randonnées.
«Vivre ici, c’est un luxe, dit-elle. On n’est pas confronté à la destruction de la planète. La seule chose qui unit les habitants est le respect mutuel: vivre et laisser vivre. La nature, c’est pour les solitaires.»
Ramona nous parle d’une de ses chansons Unearthy Delights: «Il y est question du hasard de la nature, de son arbitraire, de son chaos. La vraie nature, pas celle que l’on voit dans les parcs publics, ne se soucie pas des êtres humains.» Elle enchaîne: «Ici à Topanga, je consomme la nature. Je ne lutte plus pour la protection de l’environnement. Il y a moins de gens qui m’inspirent de la haine en détruisant notre planète. Je m’occupe
moins des autres. Cela me permet de penser à moi-même et de me concentrer sur ma musique.»
Tandis que certains se regroupent dans de petites communes nostalgiques comme Arcata, la Mecque de la protection des arbres dans le Nord de la Californie, Nite Jewel a trouvé à Topanga le cadre idyllique pour pratiquer un mode de vie écologique qui lui est propre, dénué de tout romantisme, proche de la nature, sans être particulièrement responsable.
Big Sur, Highway One.
Entre Los Angeles, la ville visionnaire, et San Francisco, le paradis de l’innovation, la nature reprend ses droits. Au volant de ma Dodge, je me dirige vers le nord. La Highway One longe la côte, l’Océan n’est parfois plus qu’à une dizaine de mètres. Je suis les méandres et les montées de l’autoroute jusqu’à Big Sur, avec ses collines boisées aux falaises abruptes. Pour les Californiens, l’expérience de la nature passe par la voiture.
A deux heures de route de Los Angeles, vous pouvez observer des otaries sur le sable ou traverser des forêts de séquoias géants.
C’est à Big Sur que vécut l’écrivain Henry Miller dès 1942 et qu’il rédigea sa critique de la société américaine: Le cauchemar climatisé. Se réfugier dans la nature fait partie de la culture californienne.
C’est là qu’ont pris naissance les premières tentatives d’ancrer l’écologie dans le quotidien. Davis, ville universitaire près de Sacramento, est le paradis de la bicyclette. Alors que les Etats-Unis commençaient tout juste de combattre la ségrégation raciale dans les années 1960, émergeait à Davis un mouvement luttant contre le symbole de la vie américaine, la voiture. Dès 1966, les écologistes imposèrent au conseil municipal une politique favorable au vélo et Davis devint le modèle mondial de la politique urbaine verte.
Fort Mason, San Francisco.
A l’est de San Francisco, la ville universitaire de Berkeley a l’esprit écolo. Cette région de la Bay Area est le paradis des start-up qui y bénéficient d’importants soutiens.
Le site «The Hub» offre des infrastructures de travail à louer. Une fois l’entreprise lancée, l’accélérateur «50 Startups» est là pour la faire décoller en o#rant un appui en termes de conseil et de "nancement. A l’étape suivante, les «incubateurs» font le lien entre jeunes pousses et mentors. C’est ainsi que les futurs Google, Apple et autres Facebook peuvent germer: une véritable serre économique.
Et l’impact social est dorénavant reconnu comme un investissement. Socap11 est le salon des entreprises et des investisseurs défendant des visions écologiques et sociales. L’événement a lieu à Fort Mason, une caserne désaffectée de la baie de San Francisco. Il réunit des hommes en costume-cravate comme des étudiants en baskets provenant de plus de 50 pays. Les ateliers ont par exemple pour thème: «Création d’entreprises en changement: la perspective écologique 3.0». Eric Schmidt, administrateur de Google, est présent, tout comme la Fondation Bill Gates ou Forbes Magazine.
Myshkin Ingawale, 29 ans, est venu de Bombay pour présenter son invention: un test sanguin électronique bon marché conçu pour le corps médical indien. Il cherche un investissement de 300$000 dollars, qu’il pourrait bien trouver ici, car il a été invité au salon par le Unreasonable Institute, favori de l’événement.
Créé il y a seulement deux ans, cet institut ne soutient que les entreprises capables d’améliorer la vie d’«au moins un million de personnes». Les candidats doivent réussir un «camp d’apprentissage» de six semaines leur permettant de se perfectionner en communication, recrutement de personnel et création de bénéfices.
L’institut tisse un réseau choisi d’investisseurs, de mentors et de jeunes entreprises.
«Quand nous avons voulu créer une entreprise sociale, nous nous sommes heurtés aux obstacles typiques de la phase de lancement», explique Teju Ravilochan, 24 ans, cofondateur de l’institut.
«Nous avons compris qu’il n’y avait pas d’argent pour ces entreprises au départ: pour accéder aux crédits, il faut des gens qui vous font con"ance. C’est pourquoi nous tissons un réseau au service des entreprises. Nos camps réunissent 25 jeunes entrepreneurs et leurs mentors dans une maison. Le jeune fondateur de start-up se brosse les dents à côté d’un grand directeur de Hewlett Packard! Et la journée se passe dans des ateliers ou au travail.»
C’est ainsi que se créent des liens de confiance pour la vie. Unreasonable Institute annonce ses camps dans plus de 70 pays. Les participants ne viennent presque jamais d’Europe, un tiers sont originaires des USA. «Beaucoup viennent d’Inde, récemment du Kenya et de l’Ouganda, relate le jeune vice-président. Pour nous, le critère décisif est la capacité du projet à prendre de l’ampleur.»
La taille, l’optimisme et les perspectives mondiales sont les atouts de l’institut.
«La Silicon Valley, c’est une façon particulière de pratiquer l’économie, fondée sur des réseaux étroits et une vision égalitaire», écrit Margaret O’Mara, spécialiste en histoire économique. Depuis l’époque de la ruée vers l’or, la capacité à prendre des risques s’allie ici aux talents venus du monde entier. Les villes de Boulder au Colorado et d’Austin au Texas travaillent sur de nouveaux modèles d’affaires et tentent de surpasser la Silicon Valley pour devenir la nouvelle Mecque de l’écologie.
Pour le professeur Michael Porter, l’entreprise réellement au service du monde est celle qui crée une «valeur partagée» (shared value), ce qui ne l’empêche pas de générer des bénéfices conséquents.
Ferry Plaza Farmer’s Market.
Peu avant le pont d’Oakland Bay, j’aperçois un marché paysan. Les fruits de bonne qualité sont rares en Californie. Les supermarchés ne vendent pratiquement que de la marchandise industrielle: calibrée, énorme, fade. Tout le contraire ici. Fréquenté par la classe moyenne écologiste de San Francisco, ce marché paysan sent bon les mets fraîchement cuisinés. La famille Bariani y vend son huile d’olive produite en Californie. La clientèle est invitée à goûter la saveur des fruits.
Jennifer, 21 ans, explique le sens des a!chettes qui garnissent les stands. «Cela fait 50 ans que nous ne faisons pas attention à ce que nous mangeons, au point de trouver normal que la nourriture sorte des usines. Puis nous sommes tous tombés malades et nous devons aujourd’hui réapprendre ce que manger veut dire.»
En 2007, les coûts du diabète s’élevaient à 174 milliards de dollars aux Etats-Unis. Près de 30% des plus de 65 ans ont développé la maladie. Des centaines d’organisations s’engagent pour un vrai changement, qui semble déjà à l’oeuvre en Californie. Les grands chefs deviennent des célébrités. Les restaurants végétaliens foisonnent.
Même les «taco trucks», les buvettes itinérantes, misent sur l’alimentation de qualité et biologique.
L’alimentation est une piste intéressante pour créer un lien entre les populations urbaines de Californie et la nature. D’abord, il y a l’expérience du goût, suivie de la conscience écologique. «Faire l’expérience du goût, se relier au rythme de la nature», dit le tract distribué par Jennifer. Point 4: «Protéger l’environnement». Une démarche logique, dès lors que l’on comprend d’où vient ce que l’on mange.
Whole Foods, Santa Monica.
Je quitte la Bay Area, le lieu rêvé des accros à la technique qui veulent lancer leur entreprise. De retour à Los Angeles, plutôt source de style de vie, je rencontre James Ferraro, un musicien de 26 ans, qui fait ses achats. Nous sommes au Whole Foods, à Santa Monica, un supermarché vert très prisé, à l’ambiance de dé"lé de mode.
«Whole Foods est un phénomène social», me dit James. Il vientde sortir un disque sur le mode de vie écolo à l’ère digitale. «Cela fonctionne comme Apple, comme toute autre chose en Californie. Le produit véhicule des valeurs symboliques. Whole Foods vend le sentiment de faire partie d’un mouvement populaire.»
En ces temps de monnaies virtuelles, le naturel devient une marchandise.
«Local» est un slogan qui désigne le lien avec la campagne. La consommation de denrées locales crée une communauté, explique une serveuse du restaurant précisément baptisé le «Local». Amelia est la bouchère préférée du lieu: «Nous achetons notre viande chez un seul fermier. La bête abattue est transportée au restaurant sous les yeux de la clientèle. La viande est dépecée, vous assistez à tout le processus.» Elle ne croit pas aux labels biologiques, mais plutôt à une économie «post-bio» basée sur les rapports de confiance.
Le besoin de nature est tellement fort que les branchés de Los Angeles vont désherber les jardins potagers communautaires urbains à la sortie de leur séance de yoga.
VELA Community Center, Los Angeles.
Plus à l’est, à 20 minutes de route, les boîtes aux lettres des maisons portent des noms espagnols. Au centre communautaire VELA, Reanne Estrada se bat pour apprendre l’alimentation saine à une poignée d’adolescents latinos. 40% des habitants de la ville sont originaires d’Amérique latine.
Parmi eux, le diabète touche même les jeunes. «Ma mère ne peut pas se payer une voiture. Pour acheter des
fruits frais, le déplacement lui prendrait des heures. Quand je suis à l’école et que j’ai faim, je n’ai pas le temps d’acheter des légumes. De toute façon, on n’en trouve pas», relate Jocelyne, 17 ans.
Le problème des «déserts alimentaires» devient tangible. Dans le quartier, il y a surtout des fast-foods et des magasins d’alcool. Le projet de Reanne s’appelle «Market Makeovers». Il vise à informer la population pour créer une demande de produits frais. Il s’agit aussi de convaincre les magasins du quartier de proposer ces
produits. Ici, la révolution verte semble encore illusoire. Et pourtant.
Un nouvel Eden.
«La Californie est le centre mondial de l’innovation technologique: on ne compte plus les inventions dans le domaine des technologies propres. C’est ici et maintenant que cela se passe», dit Jason Matlof, de la société de capital-risque Battery. «Les technologies propres poursuivent leur envol. C’est le troisième champ d’investissement après les médias électroniques et le cloud computing.»
Le futurologue Jamais Cascio, 45 ans, passe pour le prophète de la technologie verte. Il voit sa région comme un champ expérimental: «Los Angeles est l’univers en petit. Ce qui réussit ici peut réussir partout.» Selon lui, c’est la politique de subventions de la Chine qui a détruit l’industrie californienne des cellules solaires. Mais il ne perd pas espoir et travaille sur un nouveau livre qui s’intitule A New Kind of Eden.
Il y développe trois scénarios pour un avenir vert en Californie:
- Indiscutablement vert: le modèle californien du développement vert ne fonctionnera que si l’économie connaît une relance et si la population et la politique continuent d’orienter l’économie locale sur la voie écologique.
- Vert sous contrainte: si l’économie continue de stagner et si la Californie se tourne vers des infrastructures bon marché, c’està-dire les importations chinoises, la région deviendra néanmoins plus écologique, car la Chine mise à fond sur les technologies vertes.
- Vert par dépassement: malgré le déclin économique, la Californie prend son élan et devance ses concurrents par un effort de volonté. La nécessité de renouveler les infrastructures est perçue comme une chance pour la conversion écologique. La Californie
reste à la pointe du progrès.
Pour Jamais Cascio, la capacité californienne à se réinventer en permanence est le principal atout sur la voie écologique: «La Californie, c’est l’évolution par excellence.»
Disneyland.
Pour la première fois, je prends un train en
Californie. Publicité en bordure de la voie ferrée: Agrifuture présente un robot qui s’occupe d’un jardin plein d’énormes fruits. Coïncidence, les jardins communautaires robotisés sont justement l’une des visions écologiques de Jamais Cascio.
Ici à Disneyland, Tarzan vit sur un arbre en plastique. Mickey, symbole du citoyen américain moyen, possède un poulailler, tout comme les pionniers d’Echo Park. Et le train à grande vitesse roule déjà à Disneyland, alors qu’il est tant attendu dans la réalité, le projet approuvé depuis des années restant toujours lettre morte. Le métro aérien est presque vide. Sous les voies, les gens font la queue pour visiter Autopia, attraction sponsorisée par Chevron. Les rires des enfants fusent
des auto-tamponneuses dotées de vrais réservoirs à essence. A Tomorrowland, je me construis mon avenir virtuel durable sur un écran tactile, avant d’assister à la démonstration d’un véhicule équipé d’un bouton vert qui permet de passer au mode de fonctionnement écologique.
Von Hannes Grassegger
Ein Thema, das die Runde macht: Diesen April lancierte der in Winterthur ansässige Verein Ecopop eine Volksinitiative, die den Zusammenhang zwischen Umwelt (Ecologie) und Bevölkerung (Population) ins öffentliche Bewusstsein rücken soll. «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebens- grundlagen» heisst die Initiative und fordert eine Beschränkung der Nettozuwanderung in die Schweiz auf jährlich 0,2 Prozent der Bevölkerung sowie eine Verwendung von 10 Prozent der Entwicklungshilfeausgaben zur Förderung der freiwilligen Familienplanung durch Aufkläruung und besser zugängliche Verhütungsmittel in Entwicklungsländern.
Der nach eigenen Angaben 500 bis 600 Mitglieder zählende Verein sendet auf allen Kanälen. Ecopop Vorstandsmitglied Benno Büeler trat in der «Arena» auf und wurde in der Presse anschliessend als der «Grüne Messias» bezeichnet. Im selben Zuge wurde Ecopop mit seiner rechten Vergangenheit konfrontiert. Zudem schöpfen die Initianten kräftig aus dem Gedanken der wachstumskritischen Décroissance-Bewegung.
Die von allen Ecopop-Vertretern zitierte Formel:
Umweltbelastung =
Produkt aus Bevölkerungszahl X Pro-Kopf-Verbrauch
stammt noch aus dem Jargon der Vorgängerorganisation Nationale Aktion, blieb aber bis heute Grundlage der Ecopop-Weltsicht. Heutige Ecopop-Vertreter wie Büeler weisen allerdings die rechte Verortung von sich. Sie sehen sich als Tabubrecher, die das «heisse Eisen» Bevölkerungswachstum ausserhalb des politischen Links- rechts-Schemas anpackten.
In der Diskussion zu Ecopop aber wurde ein auffälliger Zusammenhang übersehen: die frappierende Ähnlichkeit der Ecopop-Ideen mit denen der Deep Ecology (Tiefenökologie), der philosophischen Grundlage radikaler Aktivisten wie Earth First und Sea Shepherd.
Auffällige Parallele zur Tiefenökologie
Der Deep-Ecology-Gründervater, der norwegische Philosoph Arne Naess (1912–2009), veröffentlichte den Aufsatz «The Shallow and the Deep» («Das Seichte und das Tiefe») im Jahr 1973. In einer Zeit, in der auch Paul Ehrlichs Buch «Die Bevölkerungsbombe» (1968) vor angeblich katastrophalen Folgen des Bevölkerungswachstums warnte. 1972 veröffentlichte der «Club of Rome» die dramatische Studie «Die Grenzen des Wachstums» und brachte die Idee «natürlicher Grenzen» wieder ins Spiel. Innerhalb eines Jahrhunderts würden "absolute Wachstumsgrenzen" erreicht, was zu einem Kollaps in der Form eines rasanten Bevölkerungsrückgangs oder Massensterbens führen würde. Oft zitieren Ecopop-Vertreter die letzteren Bücher.
Doch Arne Naess und seine Tiefenökologie scheinen bei Ecopop offiziell kein Thema zu sein. Auf Anfrage des Magazins Greenpeace verneinen die beiden Vorstandsmitglieder Sabine Wirth und Alec Gagneux, die Werke von Naess näher zu kennen. Der Zusammenhang zu Naess’ Tiefenökologie zeigt sich aber in leicht nachvollziehbaren Parallelen.
Philosoph Naess grenzt eine «tiefe» von einer «seichten» ökologischen Haltung ab: «Seicht» ist jene ökologische Perspektive, die den Menschen in den Mittelpunkt der Schöpfung stellt. «Tief» ist, was ihn als Teil eines Ökosystems sieht. Die seichte Ökologie kümmere sich nur um Wohlstand und Gesundheit der Menschen in entwickelten Ländern, statt ein «tiefes» Verständnis zu entwickeln, klagt Naess an.
Ganz anders die «tiefe» Ökologie» mit ihrer «Gesamtsicht»: Der Mensch ist Teil eines Biosystems, in welchem der Mensch prinzipiell die gleiche Wertigkeit hat wie jedes andere Element. Er geniesst also keine absolute Sonderstellung, ist nicht Herr der Schöpfung.
Gegen den Mensch als Mittelpunkt der Schöpfung
Deep Ecology wendet sich explizit gegen den Anthropozentrismus. Jedes Lebewesen, jede Spezies zählt für Naess moralisch gleich. Alles andere wäre schliesslich «Spezizismus».
Auch die Biodiversität habe einen Eigenwert an sich und darf laut Naess nur bei «vitalen Interessen» durch Menschen beschädigt werden. Interessant ist, dass bei Naess sogar die kulturelle Diversität ihren Eigenwert hat. Manche kulturelle Grenzen hält Naess für unüberbrückbar.
Von diesem «Pluralismus» ist es ein kleiner Schritt zur Vorstellung, dass verschiedene «tiefe» Ökosophien - definiert als Weisheiten des Haushalts - entstehen können. Jede tiefe Ökosophie ist für Naess eine «Philosophie ökologischer Harmonie oder Gleichgewichte».
Gleichgewicht, Diversität – im Kampf gegen die rapide Verschlechterung der ökologischen Situation könne eine Populationsminderung beim Menschen notwendig werden, wie Naess mehrfach fordert, «auch im Interesse der Menschen» selber.
Hier setzt Ecopop an. Naess selber hatte die politischen Möglichkeiten seiner Konzepte früh erkannt.
«Es gibt politische Potenziale in dieser Bewegung, die nicht übersehen werden sollten (...)», schreibt Naess 1973. Deep Ecology ist für ihn als «Pluralisten» lagerübergreifend von links nach rechts. Wichtig ist ihm auch lokale Autonomie als Form der Unabhängigkeit; der Fokus auf Lebensqualität statt auf «messbarem Lebensstandard». Wachstumskritik ahoi.
Naess’ Ausführungen zur Tiefenökologie, zur Diversität, werfen zwangsläufig Fragen zur Migration auf. Migration von Armen in reiche Länder aus wirtschaftlichen Gründen lehnt Naess ab: «Jede verantwortungsvolle ökologische Policy wird versuchen, diese abzuschrecken oder zu minimieren.» Naess bevorzugt Entwicklungshilfe vor Ort. Genau wie Ecopop.
Drastische Massnahmen
Und der Norweger dachte uber drastische Massnahmen der Geburtenkontrolle nach: In einem Text zu Populationsfragen liefert Naess Ansätze zur höheren Besteuerung von Eltern. Die Idee ist, Nachwuchs zu verhindern zum Zweck einer langfristigen Bevölkerungsabnahme. Kinder kosteten die Gemeinschaft «gleich viel oder mehr als alte Menschen», notiert der Philosoph. Er selbst starb mit 97.
Der Mythos vom vollen Boot
Nicht nur tauchen bei Ecopop Naess’ «zwei grosse Ziele» Reduktion des totalen Konsums und Reduktion der Bevölkerung zugunsten des Biosystems in der anfangs erwähnten Ecopop-Formel auf. Auch Ecopop verbreitet seit Jahren den Gedanken, dass Kinder einen Staat mehr kosten würden, als sie ihm brächten.
Ein Dunst von Eugenik und unwertem Leben schwebt über der «Philosophie». Naess – der inoffizielle Vordenker – sah sich an einem Punkt dann gezwungen, die Dinge in einem Aufsatz klarzustellen:
«Der antifaschistische Charakter der (...) Tiefen- ökologie-Bewegung» : Letztere messe jedem menschlichen Wesen den gleichen Wert bei und lasse sich nicht mit faschistischem, nationalistischem oder rassistischem Gedankengut vereinbaren.
Doch im selben Aufsatz anerkennt Naess den fundamentalen Bruch mit der Kernidee der Aufklärung: Die Kantsche Maxime, bekannt als die «goldene Regel», müsse für die Tiefenökologie erweitert werden. Aufgrund des Eigenwertes aller Wesen müsse sie lauten: «Kein lebendes Wesen sollte rein als Mittel zum Zweck benutzt wer- den.»
Klingt plausibel, bedeutet aber: Die Interessen des Menschen stehen in einem Tauschverhältnis zu denen anderer Lebewesen.
Genau dies hält Alec Gagneux, Ecopop-Vorstandsmitglied, für die Gemeinsamkeit innerhalb von Ecopop. Im Interview fordert er, dass die goldene Regel entsprechend erweitert werde. Anlässlich eines Vortrags in Zürich klopfte er sich nach einer langen Erörterung der aus dem Bevölkerungswachstum resultierenden Umweltprobleme erregt auf die Brust: «Die Philosophie vom Menschen im Mittelpunkt find ich eine Sauerei! Der Regenwurm denkt auch, er sei wichtiger als ich.»
Radikale Idee mit Integrationspotenzial?
Einer stimmt ihm laut zu: Walter Wobmann von den Schweizer Demokraten. Ein Ex-Grüner, der zur nationalistischen Partei wechselte, weil er dort die wahren Kämpfer gegen Globalisierung sah. Durch Zuwanderungsstopp wolle er die Heimat gegen eine multikulturelle Zukunft schützen, erzählte er einst. Wobmann verteilt Flugblätter, redet von «Überbevölkerung». Sein Fazit: Die Schweiz ist voll.
Trotz der nationalen Orientierung von Ecopop erklärt Sprecher Benno Büeler, dass ihm «langfristig die Massnahmen im Ausland wichtiger seien als eine Zuwanderungsbeschränkung». Es geht schliesslich um die ganze Welt als ein Biosystem. Und nicht nur in der Schweiz denkt man so. Der – liberale – amerikanische Globalisierungsanalytiker Thomas Friedman schrieb jüngst in der «New York Times» einen heftig diskutierten Beitrag unter dem so vielsagenden wie abschliessenden Titel: «Die Erde ist voll».
 Was denkt, wie fühlt ein ethischer Entrepreneur? Ein Unternehmer der Business mit Bio verbindet? Ein grüner Patron?
Was denkt, wie fühlt ein ethischer Entrepreneur? Ein Unternehmer der Business mit Bio verbindet? Ein grüner Patron?
Mit Patrick Hohmann, Gründer des Biotextilpioniers Remei, sprach Hannes Grassegger
Er ist eigentlich ein „Textiler“ der alten Schule. Ein „Patron“, dessen Sohn in der eigenen Firma arbeitet. Doch 1990, nach Jahrzehnten in der konventionellen Textilindustrie, nach einer Kindheit als Sohn eines Textilhändler in Ägypten und im Sudan, begann der Unternehmer Patrick Hohmann etwas, wofür er damals ausgelacht wurde. Hohmann wurde grün. Sehr sogar. Seit 2005 produziert sein Betrieb ausschliesslich Bioware. Ein hartes Geschäft, voller Tücken, Betrüger, Preisschwankungen. Doch Hohmann liebt das Ringen. Man müsse Werte haben in diesem Geschäft, sagt der Firmengründer, der mittlerweile an Partizipation glaubt und eine ganz eigene Unternehmensethik entwickelt hat.
Remei, der Textilhersteller aus Rotkreuz nahe Luzern ist ein klingender Name in der Biotextilwelt. Zusammen 7000 Farmer in Indien und Tanzania produzieren Baumwolle im Auftrag von Remei, das sich als Netzwerkmanager versteht. Durch ein vielstufiges Produktionssystem gelangen Remei Kleider schliesslich in die Regale von Monoprix, Coop oder Mammut. Und auch Greenpeace setzt auf Remei.
Q: Herr Hohmann, Sie verrieten mir kürzlich auf einer Besichtigung Ihrer Biobaumwollfelder in Indien, dass sich das finanziell kaum mehr lohne. Doch Sie hätten ein Versprechen gegeben, spürten Verantwortung. Wurde aus dem Geschäftsmann ein Visionär?
Auch als reiner Geschäftsmann war ich Visionär. Ich wollte viel verdienen, Karriere machen. Aber wie das Leben spielt: Man begegnet Menschen, hat Familie, Kinder. Mit fortlaufendem Alter gehen die Augen immer weiter auf. Mit 40 Jahren dachte ich, diese Wirtschaftsform die ich bisher erlebt hatte, die ist doch einfach Unfug. Ich hab gesehen, wie die Textilindustrie sich änderte. Da wollte ich einen Serviceanbieter gründen, der allen nutzt.
Wieviele Menschen arbeiten in dem Produktionsnetzwerk, dass Remei betreut?
Es sind 54 Betriebe die wir koordinieren...die Farmer...zusammen etwa zwanzig- bis dreissigtausend Menschen.
Ursprünglich waren Remei ein konventioneller Betrieb. Wie kamen sie auf Bio?
Da lag eine Werbung des WWF auf meinem Tisch, in der mit handgepflückter Baumwolle geworben wurde. Etwa 1990. Das suggerierte, handgepflückt sei etwas Gutes. Was auch stimmte, weil nicht durch Entlaubungsmittel geerntet wurde. Ich sagte mir aber: Wenn schon, dann richtig!
Weil eigentlich war handgepflückt nur in Amerika etwas besonderes. Siebzig Prozent der Baumwolle wurden ja handgepflückt. Ich ging etwas später zu meinen Spinnereien in Indien, und fragte meine Zulieferer, woher denn eigentlich ihre Baumwolle kam. „Von weit her.“ Da fragte ich einfach: Warum nehmen wir nicht Bio? Und wurde erstmal ausgelacht. Damals gab es noch keine Biobewegung. Neun Monate später stellte ich die gleiche Frage dem Spinner der Maikaal Spinnerei. Und der sagte: „Lass uns das machen.“ Wir mussten uns mühsam einen Berater suchen.
Hinter Remei stehen Sie. Sie sagten einmal, Sie seien ein Patron. Ihr Unternehmen scheint kein revolutionär-neuartiges Modell...
Fast alle Mitarbeiter sind beteiligt. (Hält ein Aktionärsregister hoch) Ein Unternehmen mit Namensaktien! Habe ich wirklich Patron gesagt? Nun, ich führe relativ breit, versuche ein guter Patron zu sein und frage meine Mitarbeiter. Ich koordiniere ein Führungsteam mit sechs Leuten. Mit mir und meinem Sohn sind nur zwei Männer in der Führungsetage.
Ein guter Patron? Was sind denn Ihre unternehmerischen Werte?
Ich möchte Qualität und Preisgerechtigkeit. Qualität heisst wirklich das Beste aus dem Produkt rauszuholen. Preisgerechtigkeit heisst so zu arbeiten, das jeder der am Geschäft teil hat, sich auch damit entwickeln kann, seinen Teil kriegt. Nicht einer sehr viel, der andere sehr wenig.
Wenn man wie ich mit tausenden Partnern zusammenarbeitet, kann man das nicht eins zu eins lösen, sondern muss Regeln aufstellen. Darin liegt die Schwierigkeit, Regeln so aufzustellen, die Mitarbeiter so zu sensibilisieren, dass sie diese Regeln anwenden wollen. Das ist der grosse Schlüssel. Das ich eine Unternehmung schaffen möchte, in der diese Regeln lebendig, in Bewegung bleiben. Wir überlegen uns bei Zahlen in den Bilanzen: wie wirkt sich unser Handeln auf die Bauern aus?
Sie denken für andere mit?
Ja! Für Farmer und für Endkunden.
Sie sagen, Ihre heutige Unternehmens-Ethik besteht darin, für Zulieferer wie Abnehmer so nützlich zu werden, dass Remei einen Wert, nicht Kosten, darstellt.
Ich glaube nicht, dass Ethik und Wirtschaft sich widerspricht. Die unethische Wirtschaft läuft aus dem Ruder. Die ethische Wirtschaft balanciert aus. Zu ethisch wird nicht mehr wirtschaftlich. Zu unethisch wird einfach überaus wirtschaftlich. Die Balance, die man zwischen Angebot und Nachfrage schaffen muss, ist etwas Verbindendes, Wertschaffendes. Daraus soll der Ertrag unserer Firma kommen. Der Nutzen unseres Unternehmens für die Kunden besteht darin, dass die Partner auch etwas mitnehmen können.
Sie experimentieren mit biodynamischen Methoden. Was bedeutet Ihnen Anthroposophismus?
Im Antroposophismus fand ich Gedanken, die eine überkulturelle Zusammenarbeit ermöglichen. Beispielsweise, dass jeder frei ist, seiner Denkenswelt zu folgen. Und im wirtschaftlichen: Jeder ist dem anderen zugewendet, es hat keinen Sinn, Wirtschaft nur für sich zu machen, sondern es ist immer für den Anderen. Drittens: Vor dem Gesetz ist jeder gleich, es gibt Regeln die für alle gelten. Wenn man sich daran hält, kann man weltweit wirtschaften, ohne zu unterdrücken oder Regeln aufzuzwängen. Wir bieten Biodynamisch als Option, aber zwingen Bauern das nicht auf.
2009 begann eine Krise in der Biocottonbranche. Zu allem Unglück traf Sie noch ein schwerer gesundheitlicher Rückschlag. Wie fanden Sie die Kraft wieder in die Firma zurückzukehren?
Das ist doch mein Leben! Ich kann es mir gar nicht vorstellen ohne dieses Ringen, dieses Bio, eigentlich noch viel mehr: diese soziale Wirtschaft. Ich will das hinkriegen, wirtschaftlich und nachhaltig zu arbeiten. Ich möchte, auch wenn das nicht immer möglich scheint, dass die Menschen die mit mir zusammengearbeitet haben, einen Vorteil aus dieser Zusammenarbeit gefunden haben. Ich habe gesehen, das ist noch nicht fertig. Das muss auf viel breitere Schultern, viel mehr Menschen, nicht einfach auf einen Patron gestellt werden. Diese Ideen des partizipativen Zusammenarbeitens, das müssen wir wirklich noch weitertragen, dass muss Formen finden über eine lange Kette, dass der Bauer bis zum Retailer durchkommt. Das alte horizontale Wettbewerbsmodell, Weber gegen Weber, ist eigentlich tot.
Wie wichtig ist es, an seinen Werten festzuhalten, wenn man in der Biobranche arbeitet?
Ich glaube, Werte sind eminent wichtig.
Wenn es um Werte, um Glauben geht, wie kann Kritik an Bio beispielsweise aus den Medien dann eine produktive Rolle einnehmen?¨
Ich bin kein Besserwisser. Und ich hab manchmal Mühe mit Kritik. Aber ich nehm das auf und denke immer: es könnte was dran sein. Kritik wird bei uns hoch angesehen. Wir versuchen das für unsere Performance zu nutzen. So war das auch als 2010 Berichte über gentechbelastete Bioware erschienen. In Folge dessen haben wir unser Kontrollsystem noch mal verschärft. Und wir haben festgestellt: wir müssen noch viel besser werden, um Gentech die Stirn bieten zu können.
Sie wiesen in ihrem Jahresbericht bereits 2009 auf schwere Unregelmässigkeiten hin. So ehrlich wie Hohmann war kein Bio sonst. Was hat es Ihnen gebracht?
Das ist mir wurscht, was die anderen dazu sagen. Wer die Wahrheit sagt, muss sich nachher nicht daran erinnern, was er gesagt hat. Der Bioanbau ist keine einfache Sache. Es ist ein ungeheures Ringen. Dieses Vorspielen von Einfachheit, das macht die Gentechnik. Das ist nicht lebendig. Wenn man lebendig arbeitet hat man Widerstände, ein Ringen. Wenn man will, dass der Andere teilnehmen kann, muss man ihm die Wahrheit erzählen.
Nun verlor Remei - vielleicht aufgrund ihrer aufwendigen Gentechkontrollen – tausende Farmer. Nehmen Sie die Gentechnik vielleicht zu ernst?
Gentechnik kann man gar nicht „zu ernst“ nehmen. Die Gentechnik ist empirisch gedachter Anbau. Zuerst kam die grüne Revolution, dann gab es zuviel Unkräuter. Man vernichtete die Unkräuter. Damit starben die nützlichen Insekten aus. Also musste man die Pflanzen spritzen. Dann haben sich die Schädlinge unter den Blättern verteilt. Dann musste man die ganze Pflanze vergiften. Gentech: Es gibt keine Ruhe in diesem System. Und auch sozial nicht: Erst haben sich die Bauern mit uns entschuldet. Dann kehrten sie zur Gentechnik zurück – und haben wieder Schulden. Wir müssen Balance finden. Das geht nicht, indem man ganze Flächen vergiftet. Wir müssen anders denken! Bioanbau setzt Kräfte ins richtige Verhältnis zueinander. Ich bin zu alt, um noch an Gentechnik glauben zu können. Ich sehe zu viele Widersprüchlichkeiten darin.
Sie haben geringere Profite durch den Mehraufwand den Sie für die ethischen Praktiken in Kauf nehmen.
Es geht uns gut, vor allem wenn ich mich mit anderen Textilunternehmen vergleiche. Wir sind in sehr schwarzen Zahlen. Doch es geht nicht um Profit. Profit ist nur eine Notwendigkeit. Wir müssen gut verdienen, um sozial zu sein. Wir wollen gut verdienen, haben da unsere Ziele, aber wir wollen nicht mehr.