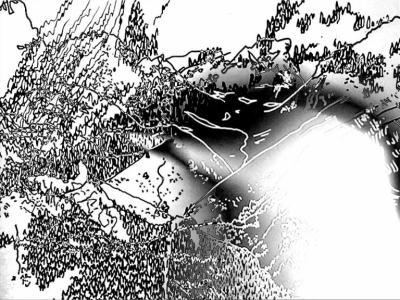Kunstwarenhaus Zürich
Mit dem am Donnerstag eröffneten Kunstwarenhaus provozieren zwei Betriebswirtschaftler den Kunstmarkt. Sie verstossen gegen die Regeln des Geschäfts.
Hannes Grassegger im Gespräch mit Salomé Stäubli und Oliver Münchow, den Eigentümern des Kunstwarenhauses.
TA: Ja was duftet hier denn so?
OM: Das beste Gegenstück zur Lachsschnitte. Bei unserer ersten Vernissage gibt es Currywurst.
Erklären Sie uns doch einmal ihr Kunstwarenhaus.
OM: Früher führte ich hier eine Galerie, und als ich die letzte Art Basel besuchte, dachte ich mir: die verlangen manchmal 200.000 Franken für nichts! Gehen Sie einmal mit so einem zeitgenössischen Kunstwerk, dass Sie in einer dieser Galerien gekauft haben zum Auktionshaus. Die wollen sowas gar nicht! Der Wiederverkaufswert ist oft zu niedrig. Ich als Ökonom sah, dass das nicht mehr rational ist, dachte das muss anders gehen. Die Idee mit dem Kunstwarenhaus kam mir, als ich merkte, wieviele meiner Freunde und Bekannten, die sich derzeit einrichten nicht einfach ein IKEA Poster für ihre Wohnung wollen. Sie wollen Unikate, nicht Deko-Art oder signierte Serien. Ihnen sind Galerien zu elitär. Man kann keine Preisspanne von 100 – 50.000 Franken öffnen, muss das Wort „Galerie“ vermeiden. Wir sagen Kunstwarenhaus. Warenhaus klingt wertiger als Supermarkt
Salomé Stäubli: Wir denken vielleicht betriebswirtschaftlich, aber ich begeistere mich privat schon seit meiner Kindheit für Kunst. Mein Vater war Sammler. Ich dachte: wenn ich gross bin, biete ich mit! Jetzt bin ich gross und kann immer noch nichts kaufen. Warum also nicht ein Geschäft eröffnen, in dem man Kunst zu fairen Preisen kaufen kann? Mich hat die Idee begeistert, die Nachfrage gibt es. Und abgedeckt wird sie nicht.
OM: Das beweist der Ansturm auf den Solothurner Kunstsupermarkt einmal im Jahr. 5.000 Exponate, jeder kann hinbringen was er in der Klubschule gelernt hat. Das ist nicht so elitär wie diese gähnend leeren Galerien. Ganz ehrlich, gehen Sie in die rein?
Ja. Aber wie sieht das Kunstwarenhaus denn nun aus?
OM: Also hier im Eingangsbereich ist die Supermarktkasse. Die hab ich ersteigert. Super, nicht? Die erste Ausstellung heisst: Pop is Hot. Acht Künstler sind im Angebot, es gibt drei Preiskategorien zwischen 40 und 4000 Franken. Gleich rechts die „Kunststückchen“, also kleine Bilder, 20 x 20 cm, oder die ZanRé Unikate in 40 x 50 cm für unter 400 Franken. Viele Kunststückchen können wir günstig anbieten, weil sie von Berliner Künstlern sind. Die haben niedrigere Produktionskosten. Geradeaus sind mittelgrosse Formate, 40 x 50 cm, die zwischen 1000 und 2000 CHF liegen. Dabei auch der Star Marco Pittori, der Paparazzi-Bilder bearbeitet. Oder Carl Smith aus dem New Yorker Urban Art Bereich. Daneben gibt’s Budget, 400 – 1000 CHF, das ist mit magentafarbenen Buchstaben angeschrieben. Im Eck dann die grossen, teuren Sammlerstücke von 2000 bis 4000 CHF, aufwendige Pop-Manga Gemälde von Evelin. Die entdeckte ich im Berliner Underground. Ein Keller, keine Galerie war das. Sehen Sie die Materialität, da wurde richtig dran gearbeitet. Sowas kostet.
SS: Was wir hier anbieten, soll preislich gerechtfertigt sein. Offen haben wir Mittwoch bis Freitag nachmittags. Und jeweils den letzten Sonntag im Monat. Und dann bieten wir ja noch die Kunstabwrackprämie.
Interessant. Was ist das?
OM: Das Wort klingt hart. Aber ich hatte so eine Idee. Ich wollte, dass man gebrauchte Kunst einlösen kann, wenn man Neuware kauft. Gegen 20% Rabatt. Als ich das Evelin am Telefon erzählte, lachte sie und sagte, dass sei eine Abwrackprämie. Ich würde das ausnutzen, auf den Flohmarkt gehen, dort günstig Kunst kaufen und hier eintauschen (lacht).
SS: Ich hoffe, dass die Leute das nicht tun. Aber sag doch mal, was wir als Kunst akzeptieren. Könnte ich einfach was selber malen?
OM: Es muss sich um Unikate zeitgemässer Kunst handeln. Und man kann nicht mit einem pappdeckelgrossen Bild kommen und dafür ein grosses Werk eintauschen. Oder mit einem Stock. Man muss auf jeden Fall sehen, dass das von einem ausgebildeten Menschen gezielt als Kunstwerk angefertigt wurde. Nicht von einem Gorilla.
Viele Figuren mit grossen Augen sieht man unter den Motiven. Wer ist denn das Team erfahrener Kunstkritiker das die Werke beurteilt, wie Sie im Pressetext schreiben?
SS: Das Team ist im Aufbau, Oliver ist derzeit damit beschäftigt. Das müssen Leute mit Sachverstand sein und Verständnis für unser Zielpublikum.
OM: Mich unterstützen Sammler aus dem Bekanntenkreis, ein Freund eines Auktionshauses, eventuell steigt die Leiterin eines Kunstfonds ein.
Und was sind Ihre nächsten Ziele?
SS: Das Ziel für mich persönlich ist mehr Zeit zu haben Kunst anzuschauen. Für unsere Kunden möchte ich, dass man hier das kaufen kann was einem gefällt. Das man hier nicht in Kunst „investiert“, sondern dem Herzen folgt. Und für unsere Künstler wünsche ich mir, dass wir ein Sprungbrett sein mögen.
OM: Oder vielleicht eher ein Einstieg?
***
www.kunstwarenhaus.ch
Hannes Grassegger im Gespräch mit Salomé Stäubli und Oliver Münchow, den Eigentümern des Kunstwarenhauses.
TA: Ja was duftet hier denn so?
OM: Das beste Gegenstück zur Lachsschnitte. Bei unserer ersten Vernissage gibt es Currywurst.
Erklären Sie uns doch einmal ihr Kunstwarenhaus.
OM: Früher führte ich hier eine Galerie, und als ich die letzte Art Basel besuchte, dachte ich mir: die verlangen manchmal 200.000 Franken für nichts! Gehen Sie einmal mit so einem zeitgenössischen Kunstwerk, dass Sie in einer dieser Galerien gekauft haben zum Auktionshaus. Die wollen sowas gar nicht! Der Wiederverkaufswert ist oft zu niedrig. Ich als Ökonom sah, dass das nicht mehr rational ist, dachte das muss anders gehen. Die Idee mit dem Kunstwarenhaus kam mir, als ich merkte, wieviele meiner Freunde und Bekannten, die sich derzeit einrichten nicht einfach ein IKEA Poster für ihre Wohnung wollen. Sie wollen Unikate, nicht Deko-Art oder signierte Serien. Ihnen sind Galerien zu elitär. Man kann keine Preisspanne von 100 – 50.000 Franken öffnen, muss das Wort „Galerie“ vermeiden. Wir sagen Kunstwarenhaus. Warenhaus klingt wertiger als Supermarkt
Salomé Stäubli: Wir denken vielleicht betriebswirtschaftlich, aber ich begeistere mich privat schon seit meiner Kindheit für Kunst. Mein Vater war Sammler. Ich dachte: wenn ich gross bin, biete ich mit! Jetzt bin ich gross und kann immer noch nichts kaufen. Warum also nicht ein Geschäft eröffnen, in dem man Kunst zu fairen Preisen kaufen kann? Mich hat die Idee begeistert, die Nachfrage gibt es. Und abgedeckt wird sie nicht.
OM: Das beweist der Ansturm auf den Solothurner Kunstsupermarkt einmal im Jahr. 5.000 Exponate, jeder kann hinbringen was er in der Klubschule gelernt hat. Das ist nicht so elitär wie diese gähnend leeren Galerien. Ganz ehrlich, gehen Sie in die rein?
Ja. Aber wie sieht das Kunstwarenhaus denn nun aus?
OM: Also hier im Eingangsbereich ist die Supermarktkasse. Die hab ich ersteigert. Super, nicht? Die erste Ausstellung heisst: Pop is Hot. Acht Künstler sind im Angebot, es gibt drei Preiskategorien zwischen 40 und 4000 Franken. Gleich rechts die „Kunststückchen“, also kleine Bilder, 20 x 20 cm, oder die ZanRé Unikate in 40 x 50 cm für unter 400 Franken. Viele Kunststückchen können wir günstig anbieten, weil sie von Berliner Künstlern sind. Die haben niedrigere Produktionskosten. Geradeaus sind mittelgrosse Formate, 40 x 50 cm, die zwischen 1000 und 2000 CHF liegen. Dabei auch der Star Marco Pittori, der Paparazzi-Bilder bearbeitet. Oder Carl Smith aus dem New Yorker Urban Art Bereich. Daneben gibt’s Budget, 400 – 1000 CHF, das ist mit magentafarbenen Buchstaben angeschrieben. Im Eck dann die grossen, teuren Sammlerstücke von 2000 bis 4000 CHF, aufwendige Pop-Manga Gemälde von Evelin. Die entdeckte ich im Berliner Underground. Ein Keller, keine Galerie war das. Sehen Sie die Materialität, da wurde richtig dran gearbeitet. Sowas kostet.
SS: Was wir hier anbieten, soll preislich gerechtfertigt sein. Offen haben wir Mittwoch bis Freitag nachmittags. Und jeweils den letzten Sonntag im Monat. Und dann bieten wir ja noch die Kunstabwrackprämie.
Interessant. Was ist das?
OM: Das Wort klingt hart. Aber ich hatte so eine Idee. Ich wollte, dass man gebrauchte Kunst einlösen kann, wenn man Neuware kauft. Gegen 20% Rabatt. Als ich das Evelin am Telefon erzählte, lachte sie und sagte, dass sei eine Abwrackprämie. Ich würde das ausnutzen, auf den Flohmarkt gehen, dort günstig Kunst kaufen und hier eintauschen (lacht).
SS: Ich hoffe, dass die Leute das nicht tun. Aber sag doch mal, was wir als Kunst akzeptieren. Könnte ich einfach was selber malen?
OM: Es muss sich um Unikate zeitgemässer Kunst handeln. Und man kann nicht mit einem pappdeckelgrossen Bild kommen und dafür ein grosses Werk eintauschen. Oder mit einem Stock. Man muss auf jeden Fall sehen, dass das von einem ausgebildeten Menschen gezielt als Kunstwerk angefertigt wurde. Nicht von einem Gorilla.
Viele Figuren mit grossen Augen sieht man unter den Motiven. Wer ist denn das Team erfahrener Kunstkritiker das die Werke beurteilt, wie Sie im Pressetext schreiben?
SS: Das Team ist im Aufbau, Oliver ist derzeit damit beschäftigt. Das müssen Leute mit Sachverstand sein und Verständnis für unser Zielpublikum.
OM: Mich unterstützen Sammler aus dem Bekanntenkreis, ein Freund eines Auktionshauses, eventuell steigt die Leiterin eines Kunstfonds ein.
Und was sind Ihre nächsten Ziele?
SS: Das Ziel für mich persönlich ist mehr Zeit zu haben Kunst anzuschauen. Für unsere Kunden möchte ich, dass man hier das kaufen kann was einem gefällt. Das man hier nicht in Kunst „investiert“, sondern dem Herzen folgt. Und für unsere Künstler wünsche ich mir, dass wir ein Sprungbrett sein mögen.
OM: Oder vielleicht eher ein Einstieg?
***
www.kunstwarenhaus.ch
hannes1 - 21. Sep, 23:15